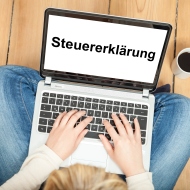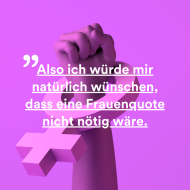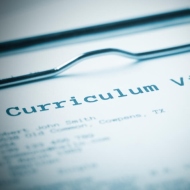Alles über Nebenjob und Karrierestart
Worauf du beim Berufseinstieg achten solltest und wie du möglichen Herausforderungen mit Selbstbewusstsein begegnest, erfährst du in diesem Artikel!
Bei Menschen mit einem hohen Emotionalen Intelligenz Quotienten wird angenommen, dass sie die Fähigkeit besitzen eigene und Gefühle anderer real einzuschätzen.
Der Wechsel aus einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis in ein Neues ist meistens ein heikles Thema. Was es mit der diskreten Bewerbung auf sich hat.
Aktives Zuhören und gekonnter Small Talk erleichtern den Alltag im Job und Studium. Welche Tricks es in der Kommunikationssteuerung gibt, erfährst du hier.
Der erste Schritt zum Traumjobm egal ob Festanstellung oder Studentenjob, ist die Bewerbung! Wir geben Tipps und Tricks, was es dabei zu beachten gibt!
Wir geben Tipps zur Vorbereitung auf dein Vorstellungsgespräch, damit du es mit einem sicheren Gefühl im Bauch in Angriff nehmen kannst.
Bonuszahlungen sind genau das, was der Name verspricht: Eine Zusatzprämie, die dein Arbeitgeber dir on top zu deinem normalen Gehalt auszahlt.
Work
Das Gespräch

Was für Möglichkeiten haben Studierende, um Geld zu verdienen und Praxiserfahrungen zu sammeln. Mini-, oder Midijob? Oder doch lieber einWerkijob?
Alle die arbeiten, haben in Deutschland einen Arbeitsvertrag, egal ob in Festanstellung, oder im Praktikum. Aber was steckt hinter den rechtlichen Grundlagen?
Der Geldbeutel ist mal wieder leer? Wir haben eine Liste mit 6 Möglichkeiten, wie du schnell an Geld kommst und wie du sogar noch sparen kannst!
Dein Studium neigt sich dem Ende zu und du stellst dir die Frage: Wie wichtig ist meine Abschlussnote? Wir sagen dir, in welchem Fach die Noten zählen
Steuerabgaben, Fristen, Sozialversicherungsbeitrag und und und: wir klären dich auf, was für dich als Student*in wichtig ist und worauf du achten musst.
Du möchtest in den Semesterferien arbeiten? Der jobmensa Karriereratgeber zeigt dir die wichtigsten Dinge, die du dabei beachten solltest!
Für viele Studierende sind Steuern Neuland. Du willst wissen, wer die Lohnsteuer zahlen muss und was noch zu beachten gilt? Die Antworten findest du im Artikel
Dir stehen Vertragsverhandlungen bevor und du weißt nicht worauf du achten solltest? Dann findest du hier wichtige Tipps und Tricks die dir helfen könnten!
Du fragst dich welche und wie viele Zeugnisse du für eine gelungene Bewerbung abgeben solltest? Tipps und Tricks findest du im Artikel!
Das Vorstellungsgespräch ist die letzte Hürde zum Job – wir zeigen euch Bewerbungsfragen und liefern die passenden Antworten dazu.
Du studierst und möchtest dir neben dem Studium etwas dazuverdienen? Dann solltest du folgende Zeit- und Verdienstgrenzen unbedingt beachten!
Alle Anstellungsformen haben Vor- und Nachteile. Wir helfen dir bei der Wahl zwischen Minijob, Werkstudentenjob und kurzfristiger Beschäftigung.
Im 2. Teil des Interviews mit Larissa Fuchs, gibt sie Antworten auf Fragen zu Vereinbarkeit von Partner*in und Karriere, Frauenquote und Elternzeit.
Larissa Fuchs forscht zum Thema Chancengleichheit. Warum sie in machen Fällen von Diskriminierung eine Chance für Geschlechtergerechtigkeit sieht:
Work
Der Minijob

Der jobmensa Karriere Ratgeber zeigt dir, was bei einem Minijob zu beachten ist. Ebenfalls kannst du dich direkt auf passende Jobs bewerben!
Work
Der Midijob

Der jobmensa Karriere Ratgeber zeigt dir, was bei einem Midijob zu beachten ist und wie sich der Midijob von Minijobs unterscheidet.
Für Geschenke und Silvesterparty soll der Rubel rollen? Wir zeigen, wo jetzt in weihnachtlicher Stimmung ordentlich Kohle verdient werden kann!
In diesem Artikel findest du alles was du über das Vorpraktikum wissen musst und Tipps für die Suche nach einem passenden Praktikumsplatz.
Wie sieht die ideale Bewerbung für einen Job als Werkstudent (m/w/d) aus? Was sollten Student*innen beachten? Alles was du wissen musst, erfährst du hier!
Du suchst nach einem Sommerjob, um in den Semesterferien dein Budget aufzubessern? In diesem Artikel stellen wir dir interessante und gut bezahlte Jobs vor!
Ein gutes Arbeitszeugnis ist die Eintrittskarte für einen attraktiven Job. Was steht drin und welche Noten stecken hinter den Formulierungen?
Du bist bald mit deinem Bachelor oder Master fertig und fragst dich so langsam, wie man in den Arbeitsmarkt einsteigt? Hier findest du die Antworten!
Selbstbewusstsein gibt dir Halt und bringt dich in deiner Karriere weiter. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du es dauerhaft stärken!
Beim Vorstellungsgespräch kann vieles schiefgehen. Erfahre was du bei und nach dem Gespräch beachten solltest, damit nichts mehr schiefgehen kann.
Beim Vorstellungsgespräch kann vieles schiefgehen. Mit ein paar einfachen Tipps & Tricks kannst du jedoch überzeugen und Fehler vermeiden.
Du möchtest dich nach dem Abi oder Abschluss sozial engagieren? Hier findest du einen Überblick über FSJ, FSJ im Ausland oder dem Bundesfreiwilligendienst.
Die richtige Kommunikation führt zu einem guten Miteinander und fördert die Karriere. Ob Small Talk oder Schlagfertigkeit, Jobmensa hilft.
Fremdsprachenkenntnisse sind aus der heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Oft müssen Sprachtests bestanden werden. Alles dazu findet ihr hier.
Ein Studentenjob bringt viele Vorteile. Berufserfahrung, Geld und Flexibilität. Wie die Bewerbung gelingt, liest du im Jobmensa Karriere Ratgeber.
Der Direkteinstieg bietet jenen, die genau wissen wohin sie wollen, die Chance, schnell eine attraktive Stelle zu ergattern. So gelingt es auch dir.
Das Bewerbungsfoto ist für den Erfolg deiner Bewerbung mitentscheidend. Jobmensa zeigt dir, wie du zum perfekten Bewerbungsfoto kommst.
jobmensa hat eine Studie durchgeführt und untersucht, welche Studentenjobs die lukrativsten sind. Hier erfährst du, wo man am besten verdient!
Jobmensa hat eine Studie durchgeführt und präsentiert die beliebtesten Jobs als studentische Aushilfe, jeweils pro Studiengang und Branche.
Unfreundliche Kunden, Stress und kein Tageslicht? Stimmt nicht immer! Wir sprechen mit Studenten über ihre Nebenjobs im Callcenter.
Du studierst Soziale Arbeit oder Ähnliches und suchst eine Stelle in diesem Bereich? jobvalley und das Bistum Limburg bieten dir viele Möglichkeiten!
Ein Schülerpraktikum gibt dir erste Einblicke in den Arbeitsalltag und macht sich gut auf deinem Lebenslauf. Mehr dazu im Jobmensa Ratgeber.
Ein Aushilfsvertrag ist ein meist zeitlich begrenzter Vertrag, um vorübergehenden Bedarf an Personal zu decken. Hier findest du die wichtigen Infos!
Du fragst dich, welche Vorteile man als Werkstudent hat und auf was man achten sollte? Alle Antworten findest du in diesem Artikel!
Auf eigene Rechnung zu arbeiten kann Sinn machen. Wir erklären dir alles wichtige zum Arbeiten auf Rechnung - Der Jobmensa Karriere Ratgeber.
Eine kurzfristige Beschäftigung bringt Flexibilität und Steuervorteile. Alles was es zu wissen gibt, erfährst du im Jobmensa Karriere Ratgeber.
Du studierst und bist auf der Suche nach einem Job? Du fragst dich, was die Zeitarbeit bei jobvalley anders macht? Dann bist du hier genau richtig!
Ein erster Erfolg ist die Einladung zu einem Telefoninterview. Lese hier, wie du in diesem überzeugst, damit du dich persönlich vorstellen darfst.
Welche sind die beliebtesten Studentenjobs? Wirken sich Fachkenntnisse auch auf den Lohn aus? Die neue Studie von jobvalley, gibt Antworten!
Wie viel persönliche Nähe sollte man im Job zulassen, und wann sollte man besser Distanz wahren? jobmensa erklärt die Dos und Don`ts zu diesem Thema.
Minijob, Werkstudent, Trainee: Es gibt viele Arbeitsmodelle, die dir der Jobmensa Karriere Ratgeber aufzeigt. Finden das Jobmodell das zu dir passt!
Work
Teilzeitjob
Teilzeitjobs sind vor allem bei Studierenden beliebt. Was du dabei beachten solltest und welche Rechte du hast, erfährst du in diesem Artikel!
Für viele ist die Angabe der Gehaltsvorstellung ein Stolperstein in so mancher Bewerbung. Wie du ihn umgehst, erfährst du in diesem Artikel!
Überstunden sind ein heikles Thema. Wie viele Überstunden muss man machen, ab wann gibt es einen Ausgleich? Diese Fragen klärt der Jobmensa Ratgeber.
Du hast Angst vor deinem anstehenden Vorstellungsgespräch? Hier findest du die häufigsten Fragen um dich perfekt auf dein Bewerbungsgespräch vorzubereiten!
Welchen Urlaubsanspruch haben eigentlich Berufseinsteiger, Praktikanten oder Werkstudenten? Alles rund um das Thema, jetzt auf Jobmensa.
Ob Studium oder Job, richtig zu präsentieren, ist eine wichtige Fähigkeit. Präsentationen können bleibenden Eindruck hinterlassen. Tipps gibt es hier.
Was bedeutet eigentlich Sozialversicherungsbeitrag, wie setzt er sich zusammen und wer muss ihn zahlen? Alle Infos dazu im Jobmensa Karriere Ratgeber.
Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnisse gehören zu jeder Bewerbung. Jobmensa hilft dir dabei die perfekte Bewerbungsunterlagen zu erstellen.
Arbeiten in den Schulferien bringt dir als Schüler den Vorteil, dass du Geld verdienst und trotzdem die Schule nicht vernachlässigen musst.
Der Minijob bietet viele Vorteile. Informiere dich im Jobmensa Ratgeber und bewirb dich auf attraktive Minijobs während deines Studiums!
In welcher Branche sieht deine berufliche Zukunft rosig aus? Was sind die Zukunftsbranchen in Deutschland? Mehr dazu im Karriere Ratgeber.
Für die Arbeit an Feiertagen gelten einige besondere Regelungen. Warum manche Feiertagsregelungen den Studenten durchaus zugute kommen, jetzt hier.
Durch Corona können Studierende kaum noch Geld in Gastronomie & Co. verdienen. Wir nennen Alternativen und durchschnittliche Stundenlöhne.
So viel Zeit investierten Hochschülerinnen und Hochschüler durchschnittlich in den Nebenjob während ihres Studiums in Deutschland.
Informiere dich hier über das Praktikum. Ob freiwilliges oder Pflichtpraktikum im Studium. Jobmensa bietet dir zusätzlich gute Praktika an.
Die richtige Vorbereitung aufs Vorstellungsgespräch ist die halbe Miete! Ob richtige Kleidung oder inhaltliche Vorbereitung ‒ darauf musst du achten!
Diese Nebenjobs sind unter Studenten besonders beliebt, da Sie interessante Praxiserfahrungen mit einer guten Vergütung verbinden.
Bei einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann ein Aufhebungsvertrag geschlossen werden. Hier bekommst du alle Infos dazu!
Was passiert im Krankheitsfall? Wann hat man Anspruch auf Lohnfortzahlung und gilt das auch für Praktika und Studentenjobs? Alle Infos, hier.
Ein Arbeitsvertrag kann voller Fallstricke sein. Ob unbefristet oder befristet, der Teufel steckt im Detail. Im Jobmensa Ratgeber klären wir dich auf!
In den Semesterferien Vollzeit arbeiten und finanzielle Löcher stopfen? Oder fachnahe Erfahrungen sammeln? Wir zeigen dir, wie das 2021 geht!
Die Arbeitszeit ist ein wesentlicher Bestandteil im Arbeitsvertrag. Welche Pflichten und Rechte damit einhergehen, beleuchtet der Jobmensa Ratgeber.
Die Antwort: Der FAIR-Index, der sowohl menschengemachte als auch auf Algorithmen verursachte Diskriminierung bei der Jobsuche sichtbar machen kann.
Du möchtest in der volesungsfreien Zeit ordentlich Geld verdienen? Wir haben die Hard Facts zum Thema Vollzeitjob in den Semesterferien.
Momentan werden in vielen Bereichen studentische Aushilfen gesucht. Nutze die Chance und pack mit an. Wir lassen uns trotz Corona nicht unterkriegen!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, als Student*in nebenbei etwas Geld dazuzuverdienen, aber welches ist das beste Arbeitsmodell für Studierende?
Muss ich als Student Steuern zahlen, und wenn ja, wie viele? Die Antworten und eine Erklärung zum Brutto-Netto-Phänomen liefern wir dir hier.
Jan und Pavel arbeiten über Studitemps beim Fahrradgeschäft Lucky Bike in München und geben Einblicke in ihren Studentenjob als Verkaufsaushilfe.
Wir haben uns für euch mit Studentenjobs in Semesterferien befasst und zeigen euch, wie eure Steuern und Versicherungen geregelt sind.
Studentenjob gefällig? Zwei Mitarbeiter haben uns verraten, wie ein studentischer Einsatz bei Dräger aussieht, bei der Überwachung industrieller Großanlagen.
Surfen, telefonieren, rauchen oder der Arztbesuch: Wie viel an Privatem ist im Job erlaubt und wo geht der Arbeitszeitbetrug los? Hier erfährst du mehr.
80% unserer Kommunikation laufen über die Körpersprache ab. Nutze deshalb die Körpersprache zu deinem Vorteil! Wir verraten dir, wie's geht.
Unkündbarkeit ist heutzutage nur noch ein Mythos. Wie du dich trotzdem im Job unverzichtbar machst? Unsere 7 Tipps verraten es dir!
In unseren 20ern haben wir mit ganz schön vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Diese 10 Fähigkeiten helfen dir, sie erfolgreich zu meistern!
Wie macht man es richtig? Duzen oder Siezen beim Vorstellungsgespräch? In diesem Artikel sagen wir euch, wie ihre es richtig macht:
Im Studium hangeln wir uns oft von einem miesen Nebenjob zum nächsten. Wie du die später im Bewerbungsgespräch gut verkaufst, erfährst du hier!
Welcher Studentenjob ist der richtige für dich? Wir stellen die 7 besten Nebenjobs vor und verraten dir, wie du den perfekten Job findest!
Nebenjob und Studium unter einen Hut zu bekommen ist gar nicht so leicht. Wir haben 4 nützliche Tipps, wie du Studentenjob und Uni vereinbarst.
Übernahme im Studentenjob nach dem Studium? Wir haben mit jungen Menschen gesprochen, denen der Berufseinstieg auf diese Art geglückt ist.
Laut dem aktuellen Arbeitsmarktbericht für Akademiker sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Akademiker gut - jedoch nicht für alle Fächer gleichermaßen.
Für Personaler*innen kommt es auf eigene Leistungen an statt die der Eltern. Ob Papa Chirurg ist, ist egal. Wir sagen, was nicht mehr in den Lebenslauf gehört.
Neben dem Anschreiben und dem Foto ist vor allem der Lebenslauf sehr wichtig bei einer Bewerbung. Wir haben zehn unschlagbare Tipps für euch.
Dein Nebenjob nervt nur noch? Dann ist es höchste Zeit für einen Jobwechsel! Wir verraten dir, was es bei der Kündigung zu beachten gibt.
Ein Standardjob ist dir zu langweilig? Dann lass dich für deine Berufswahl von dieser Liste von außergewöhnlichen Jobs inspirieren!
Dein Studium ist vorbei, die Zukunft steht vor der Tür. Was willst du aus ihr machen? Vielleicht ist eine Stelle als Trainee genau das Richtige für dich!